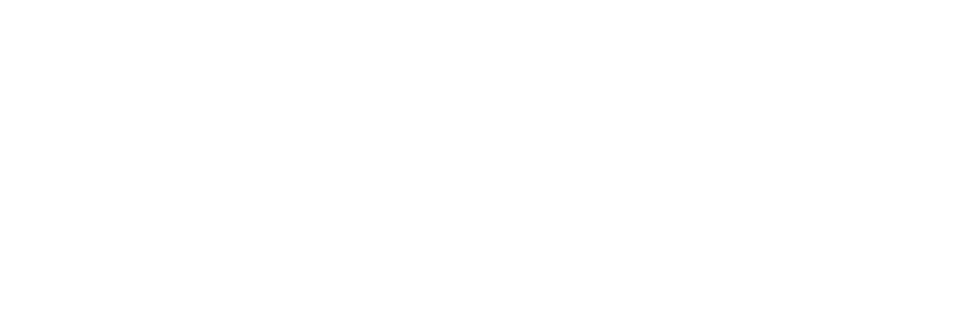Eine wahre Geschichte
Eine wahre Geschichte
Gegendarstellung
Gegendarstellung
Wie ein kulinarisches Kulturgut zu Unrecht vom Sockel verdrängt wurde.
«Das Conchieren ist einer der bedeutendsten Schritte in der Schokoladenherstellung. Hierbei werden Wasser und unerwünschte Aromastoffe ausgetrieben und die Textur der Schokoladenmasse ausgebildet (Experiment- und modellbasierte Unterstützung des Conchierens dunkler Schokoladen, Fraunhofer IVV)».
2007 ging als Revolutionsjahr in die Geschichte der Mobiltelefonie ein. Auf dem bestehenden Markt war das Iphone ein vollkommen neues Produkt. In ähnlicher Form revolutionierte die Berner Schmelzschokolade den Schokoladenmarkt von anno 1879. Nur wenige Städte haben die Entwicklung eines globalen Genussmittels derart stark geprägt wie Bern. An einer Hausfassade im Mattequartier stand einst sogar geschrieben:
«Chocolade – die berühmte Berner Spezialität».
Doch wie diese stolzen Worte sind in der Geburtsstadt der modernen Schokolade auch die Erinnerungen an diese Schweizer Genussgeschichte verblasst. Wenn man bedenkt, dass R. Lindt in Bern auf die Welt kam und später zum wichtigsten Schokoladenpionier der Schweiz wurde, ist dieser Erinnerungsverlust umso aussergewöhnlicher. Wie konnte seine Geschichte ausgerechnet in der Bundesstadt eines Schokoladenlandes vergessen gehen?
Der vorliegende Text versucht dieser Frage nachzugehen und richtet sich an «Bären» und «Bärinnen», aber auch an Genussmenschen ausserhalb von Bern. Bei der Suche nach Antworten stolpert man zwangsläufig über die bekannteste Biografie von R. Lindt, welche in «Patriarchen» zu finden ist. In diesem Buch beginnt seine Geschichte wie folgt:
«Er war ein Dandy, ein hübscher und verwöhnter Sohn vornehmer Burger und alles andere als ein Kaufmann oder Techniker».
Diese Beschreibung wirkt auf den ersten Blick harmlos, weil sie leicht ironisch formuliert ist. Dieses Muster zieht sich durch den gesamten Text. Auf diese Weise entsteht das Portrait eines «verurteilten» Schokoladenfabrikanten, welcher eher ein «Faulpelz» und deshalb nur mit «Anfängerglück» erfolgreich gewesen sein soll. Die Textpassage über die Trennung zeigt beispielhaft, wie die Berner Seite zum Sündenbock gemacht wird. Sie ist daher das Paradebeispiel aus dem Buch. Es sind jedoch Gerichtsurteile vorhanden, in welchen der Sachverhalt völlig anders dargelegt wird. Diese objektive Grundlage ermöglicht, eine inhaltliche Prüfung der Biografie. Die Diskrepanzen weisen dabei auf verschiedene Unwahrheiten im Buch hin.
Auf der Spurensuche stösst man zudem auf eine Legende, welche auf einer krassen Fehlannahme beruht. Es ist nämlich ein Trugschluss, dass die Mühle von R. Lindt bereits weitgehend automatisiert gewesen sei. Tatsächlich war die Produktion der Berner Schmelzschokolade noch stark handwerklich geprägt. Nach der Textanalyse wird sich die Legende ausserdem als verfängliches Kommunikationsinstrument entpuppen. Durch die Hintergrundinformationen über den Streit und zwei Todesfälle verliert die vermeintlich harmlose Legende allerdings rasch an Harmlosigkeit. Das Adjektiv «zartbitter» bezieht sich auf Dunkle Schokolade, die im Deutschen Sprachraum auch Zartbitterschokolade genannt wird.
Aufgrund der Quellenprüfung muss überdies auch die Objektivität infrage gestellt werden. Der Text in «Patriarchen» erhält dadurch eine eher fragwürdige Duftnote. Da der Autor auch Historiker ist und die weiteren Wirtschaftsbiografien im Buch sachorientiert daherkommen, wird sein Text häufig in den Medien zitiert. So konnte sich die süffige Legende eines Zufallswochenendes zur wohl bekanntesten Abwertung von R. Lindt mausern.
Es ist also höchste Eisenbahn, um eine teils unwahre zu einer wahren Geschichte zu transformieren. Für die Richtigstellung können die fehlenden Informationen zwischen den Zeilen mit verschiedenen Fundstücken aus meiner Recherche ergänzt werden. Das wichtigste Dementi folgt aber gleich zu Beginn: Es gab keine Verurteilung von R. Lindt. Wer sich zudem an den Fakten orientieren möchte, sollte die Legende nicht weiterverbreiten. Es gibt verschiedene ungerechte Schokoladenthemen. Diese Arbeit belichtet eine dunkle Schokoladenseite der Schweizer Geschichte und kann aufzeigen, dass dieses kulinarische Kulturgut zu Unrecht durch den Kakao gezogen wurde. Damit versuche ich einen Beitrag zur Rehabilitierung von R. Lindt zu leisten.
Die «ursprüngliche» Essschokolade wird nachfolgend Ur-Schokolade genannt. Wenn vom Berner Verfahren gesprochen wird, ist damit das Schmelzschokoladenverfahren gemeint. Am Ende des Abschnittes über die Folgen begründe ich diese Wortwahl.
«Das Conchieren ist einer der bedeutendsten Schritte in der Schokoladenherstellung. Hierbei werden Wasser und unerwünschte Aromastoffe ausgetrieben und die Textur der Schokoladenmasse ausgebildet (Experiment- und modellbasierte Unterstützung des Conchierens dunkler Schokoladen, Fraunhofer IVV)».
2007 ging als Revolutionsjahr in die Geschichte der Mobiltelefonie ein. Auf dem bestehenden Markt war das Iphone ein vollkommen neues Produkt. In ähnlicher Form revolutionierte die Berner Schmelzschokolade den Schokoladenmarkt von anno 1879. Nur wenige Städte haben die Entwicklung eines globalen Genussmittels derart stark geprägt wie Bern. An einer Hausfassade im Mattequartier stand einst sogar geschrieben:
«Chocolade – die berühmte Berner Spezialität».
Doch wie diese stolzen Worte sind in der Geburtsstadt der modernen Schokolade auch die Erinnerungen an diese Schweizer Genussgeschichte verblasst. Wenn man bedenkt, dass R. Lindt in Bern auf die Welt kam und später zum wichtigsten Schokoladenpionier der Schweiz wurde, ist dieser Erinnerungsverlust umso aussergewöhnlicher. Wie konnte seine Geschichte ausgerechnet in der Bundesstadt eines Schokoladenlandes vergessen gehen?
Der vorliegende Text versucht dieser Frage nachzugehen und richtet sich an «Bären» und «Bärinnen», aber auch an Genussmenschen ausserhalb von Bern. Bei der Suche nach Antworten stolpert man zwangsläufig über die bekannteste Biografie von R. Lindt, welche in «Patriarchen» zu finden ist. In diesem Buch beginnt seine Geschichte wie folgt:
«Er war ein Dandy, ein hübscher und verwöhnter Sohn vornehmer Burger und alles andere als ein Kaufmann oder Techniker».
Diese Beschreibung wirkt auf den ersten Blick harmlos, weil sie leicht ironisch formuliert ist. Dieses Muster zieht sich durch den gesamten Text. Auf diese Weise entsteht das Portrait eines «verurteilten» Schokoladenfabrikanten, welcher eher ein «Faulpelz» und deshalb nur mit «Anfängerglück» erfolgreich gewesen sein soll. Die Textpassage über die Trennung zeigt beispielhaft, wie die Berner Seite zum Sündenbock gemacht wird. Sie ist daher das Paradebeispiel aus dem Buch. Es sind jedoch Gerichtsurteile vorhanden, in welchen der Sachverhalt völlig anders dargelegt wird. Diese objektive Grundlage ermöglicht, eine inhaltliche Prüfung der Biografie. Die Diskrepanzen weisen dabei auf verschiedene Unwahrheiten im Buch hin.
Auf der Spurensuche stösst man zudem auf eine Legende, welche auf einer krassen Fehlannahme beruht. Es ist nämlich ein Trugschluss, dass die Mühle von R. Lindt bereits weitgehend automatisiert gewesen sei. Tatsächlich war die Produktion der Berner Schmelzschokolade noch stark handwerklich geprägt. Nach der Textanalyse wird sich die Legende ausserdem als verfängliches Kommunikationsinstrument entpuppen. Durch die Hintergrundinformationen über den Streit und zwei Todesfälle verliert die vermeintlich harmlose Legende allerdings rasch an Harmlosigkeit. Das Adjektiv «zartbitter» bezieht sich auf Dunkle Schokolade, die im Deutschen Sprachraum auch Zartbitterschokolade genannt wird.
Aufgrund der Quellenprüfung muss überdies auch die Objektivität infrage gestellt werden. Der Text in «Patriarchen» erhält dadurch eine eher fragwürdige Duftnote. Da der Autor auch Historiker ist und die weiteren Wirtschaftsbiografien im Buch sachorientiert daherkommen, wird sein Text häufig in den Medien zitiert. So konnte sich die süffige Legende eines Zufallswochenendes zur wohl bekanntesten Abwertung von R. Lindt mausern.
Es ist also höchste Eisenbahn, um eine teils unwahre zu einer wahren Geschichte zu transformieren. Für die Richtigstellung können die fehlenden Informationen zwischen den Zeilen mit verschiedenen Fundstücken aus meiner Recherche ergänzt werden. Das wichtigste Dementi folgt aber gleich zu Beginn: Es gab keine Verurteilung von R. Lindt. Wer sich zudem an den Fakten orientieren möchte, sollte die Legende nicht weiterverbreiten. Es gibt verschiedene ungerechte Schokoladenthemen. Diese Arbeit belichtet eine dunkle Schokoladenseite der Schweizer Geschichte und kann aufzeigen, dass dieses kulinarische Kulturgut zu Unrecht durch den Kakao gezogen wurde. Damit versuche ich einen Beitrag zur Rehabilitierung von R. Lindt zu leisten.
Die «ursprüngliche» Essschokolade wird nachfolgend Ur-Schokolade genannt. Wenn vom Berner Verfahren gesprochen wird, ist damit das Schmelzschokoladenverfahren gemeint. Am Ende des Abschnittes über die Folgen begründe ich diese Wortwahl.
Struktur
Struktur
Methodik
Methodik